Vor rund zwei Monaten stocken die Universitären Psychiatrischen Dienste des Kantons die Krisenintervention bei Heranwachsenden kräftig auf. 15 bis 20 neue Stellen waren im ganzen Kanton vorgesehen. Die Leiterin der Aussenstelle Spiez, Elisabeth Merklin, erklärt, wie das neue Programm die Situation im Oberland verändert.

Frau Merklin, was ist das für ein neues Programm?
Elisabeth Merklin: Es ist die AKI-KJP, die ambulante Krisenintervention der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die eine rasche Hilfe ermöglichen soll. Die Kinder, Jugendlichen sowie deren Familien haben Termine mit Psychologinnen und Psychologen sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die auch zu den Familien nach Hause gehen, sodass man vor Ort mit der Familie schauen kann, welche Art der Unterstützung gebraucht wird, um die Situation zu stabilisieren. AKI-KJP dient der Überbrückung, bis eine reguläre Behandlung stattfinden kann.
Was heisst reguläre Behandlung?
Ein Therapieplatz in dem Setting, welches indiziert ist. Das kann ambulant mit regelmässigen Terminen sein oder teilstationär in unserer Tagesklinik in Spiez. Die Kinder kommen am Morgen zu uns, haben tagsüber Schule sowie Therapien und Familiengespräche. Um 16.00 Uhr gehen sie spätestens wieder.
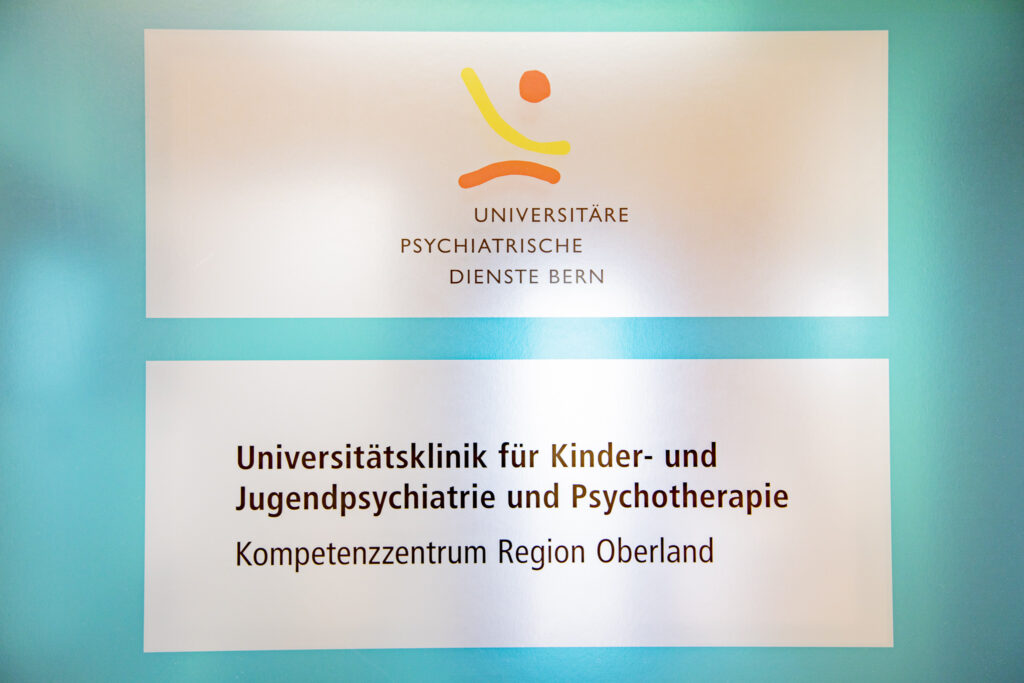
In einigen Fällen empfiehlt sich eine stationäre Behandlung. Das ist für manche Familien schlimm, weil das Kind dann während der Behandlungszeit unter der Woche nicht mehr nach Hause kommt. Zudem gibt es keine solche Einrichtung im Oberland, das heisst, die Kinder und Jugendlichen müssen nach Bern.
In welchen Fällen wird eine stationäre Behandlung empfohlen?
Ein stationärer Aufenthalt ist dann angezeigt, wenn bei schweren Krisen oder psychischen Problemen eine Behandlung im ambulanten oder teilstationären Setting nicht mehr ausreicht. Damit eine Behandlung teil-stationär funktioniert, muss die Familie genug Ressourcen haben, um die Abend- und Wochenendsituation meistern zu können. Das ist glücklicherweise häufig der Fall, aber eine teil-stationäre Behandlung verlangt den Familien dennoch einiges ab.

Wie meinen Sie das?
Unsere Patienten sind zwar «nur» Kinder und Jugendliche von der ersten Klasse bis zur Volljährigkeit, aber häufig ist bei einer psychischen Erkrankung die ganze Familie betroffen. Darum haben wir in der Tagesklinik einen sehr familien-therapeutischen Ansatz. Zusätzlich zu regelmässigen Familiengesprächen haben wir ein Mal pro Woche einen Multifamilientag, bei dem mindestens ein Elternteil anwesend sein muss. Und Zuhause muss das, was wir besprechen, dann natürlich auch umgesetzt werden. Das erfordert ganz schön viel Mitarbeit von den Eltern.
Zudem kommen die Kinder aus dem ganzen Oberland, etwa auch von Wengen oder Meiringen. Die meisten kommen zwar mit dem ÖV, aber gerade jüngere Kinder oder solche ohne gute ÖV-Anbindung müssen häufig gefahren werden.

Das heisst, ohne Eltern ist eine Therapie gar nicht möglich?
In den meisten Fällen nicht. Darum fragen wir die Eltern im Vorgespräch immer: «Könnt ihr noch?» Leider ist es häufig so, dass die Familien erst zu uns kommen, wenn sie bereits am Rand der Erschöpfung sind. Denn auch wenn eine Behandlung teilweise und vor allem auf Dauer eine Entlastung ist, ist sie gerade am Anfang sehr anstrengend.
Was glauben Sie, woran liegt es, dass man erst so spät Hilfe sucht?
Es ist zwar schon viel besser geworden, aber psychische Erkrankungen haben noch immer ein gewisses Stigma. Das hält viele davon ab, sich die Hilfe zu suchen, die sie benötigen. Zudem ist vielen am Anfang meist gar nicht klar, dass das, was sie erleben, nicht normal ist. Darum ist es wichtig, dass Eltern, Lehrer und andere Bezugspersonen den Kindern gut zuhören und im Zweifelsfall Hilfe suchen.
Elisabeth Merklin, Leiterin des Kompetenzzentrums in Spiez, erklärt das neue Programm AKI-KJP.
Das ist ja kein neues Problem. Wieso gibt es die AKI-KJP erst jetzt?
Bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es schon länger eine steigende Nachfrage. Durch die Corona-Pandemie ist diese jetzt aber nochmals deutlich gestiegen und die Wartefristen für einen regulären Therapieplatz – egal ob ambulant, teilstationär oder stationär – sind mittlerweile so lang, dass es zum Teil prekär geworden ist.
Wie lange sind die Wartefristen aktuell?
In der Tagesklinik gibt es zwar nur zehn Plätze, aber dort haben wir die Möglichkeit, auch mal eine Person mehr aufzunehmen, wenn es Symptomatik und Gruppenkonstellation zulassen. Daher dauert es dort selten mehr als vier Wochen. Im stationären und ambulanten Bereich kann es dagegen bis zu drei Monate dauern. Und das ist für jemanden, der etwa schwer depressiv oder suizidal ist, viel zu lang.

Und mit dem neuen Programm können diese Wartezeiten nun verkürzt werden?
Das nicht. Aber mit AKI-KJP, der ambulanten Krisenintervention der Kinder- und Jugendpsychiatrie, können wir jetzt dabei helfen, die Wartezeit bis zum regulären Angebot zu überbrücken. Das heisst, die Familien werden in einer äusserst schwierigen Situation intensiv begleitet.
Und das war vorher anders?
Auch schon davor gab es im Ambulatorium die Möglichkeit von Krisenterminen. Das heisst, in dringlichen Fällen bekommt der Patient innerhalb von 72 Stunden einen Termin, bei dem man schaut, wie man diese akute Krise auffangen kann. Zudem gibt es in Bern das Notfallzentrum, das bei akuter Fremd- oder Selbstgefährdung niemanden abweist. Im letzten Jahr hatten sie dort teilweise eine 200-prozentige Überbelegung.

Wie viele Kinder sind aktuell in Spiez auf der Warteliste?
Bei der Tagesklinik haben wir im Moment praktisch keine Wartefrist. Das ist vor und während den Sommerferien aber recht häufig, da die Aussicht auf Ferien zum Teil für Entspannung sorgt. Im Ambulatorium warten im Moment rund 40 Kinder auf eine Abklärung und 24 auf einen Behandlungsplatz
Das klingt nach ganz schön vielen.
Das stimmt. Aber man muss dazu sagen, dass diese Fälle nicht alle gleich dringend sind. So hart es klingt: Wenn ein Jugendlicher mit depressiven Zügen Schwierigkeiten hat, am Morgen aufzustehen, passiert nichts wahnsinnig Schlimmes, wenn er das noch ein paar Wochen länger macht. Trotzdem leiden er und seine Familie natürlich und es wäre schön, wenn wir ihn sofort in Behandlung nehmen könnten. Aber das ist leider nicht immer möglich.

Gehören Depressionen zu den häufigeren psychischen Störungen der Oberländer Kinder?
Wir haben einen Querschnitt aus allen bekannten Störungsbildern. Bei den Jüngeren sind es tendenziell mehr Buben und externalisierende, also nach aussen gelagerte Störungen wie etwa ADHS, bei den Älteren sind es tendenziell mehr Mädchen und internalisierende, also nach innen gelagerte Störungen wie Ängste und Depressionen.
Wie lange bleiben die Kinder durchschnittlich in Behandlung?
In der Tagesklinik bleiben die Kinder und Jugendlichen meistens etwa zwei bis drei Monate. Immer wieder fragen Familien an, ob ein Kind das nächste Schuljahr bei uns in Behandlung verbringen darf und dann sagen wir ganz klar: «Nein». Zum einen soll die Therapie nicht zur neuen Normalität werden, sondern dabei helfen, die Normalität im realen Leben zu finden.

Zum anderen müssen wir immer das Gesamtbild im Auge behalten. Immer wieder werden wir gebeten, die Behandlungszeit noch um ein paar Wochen zu verlängern, nur um sicherzugehen. Aber jedes Kind, das länger bleibt, nimmt einem anderen Kind, das Hilfe braucht, den Platz weg. Darum ist unsere Devise: So kurz wie möglich, aber so lang wie nötig.
Zur Person Elisabeth Merklin (44) ist Psychotherapeutin und leitet das Kompetenzzentrum Oberland, bestehend aus dem Ambulatorium und der Tagesklinik in Spiez, welche sie mitaufgebaut hat. Sie arbeitete zunächst in der Erwachsenenpsychiatrie, bevor sie in die Kinderpsychiatrie wechselte, weil sie die Arbeit mit der ganzen Familie und dem erweiterten Umfeld wie der Schule besonders schätzt.
